
Zurück im Amazonas-Regenwald.
Ich liege in meiner Hängematte, der Dschungel lächelt mich an. Ich bin willkommen. Hier gibt es keine Gefahr. Eine Libelle hält direkt vor meinem Gesicht inne, schwebt in der Luft und schaut mich
an, während ihre halb durchsichtigen Flügel ein Muster in die Unsichtbarkeit der Luft malen – wie in einer Vision, realer als ein Traum und doch irgendwie surreal.
Du siehst mich, Mama Selva – und ich sehe dich.
Mein Verstand rebelliert noch einige Tage, etwa drei. Dann wird er stiller. Die Pflanzen laden mich ein, anzukommen, Vertrauen zu fassen, bis ich mich sicher fühle. Die Liebe fließt durch meinen Körper. Alles ist gut – und es gibt nichts weiter zu tun.
Als ich vor zwei Jahren das erste Mal beschloss, nach Peru in den Dschungel zu reisen, hatte ich Angst vor Dingen, die mir heute vollkommen absurd erscheinen: der große, wilde Dschungel mit
seinen giftigen Tieren und Pflanzen, schamanische Arbeit in einer mir fremden Kultur. Zehn Tage draußen schlafen, in einem Tambo – ein mit Palmblättern
gedecktes Bretterhaus auf Stelzen mit Matratze und Moskitonetz. Kein Strom, kein fließendes Wasser (außer dem Fluss). Pflanzensude trinken. Zwölf Stunden Dunkelheit. Allein sein. Schweigen.
Lauschen.
Und trotzdem: Ein nach Hause kommen.
Ich badete im Fluss, so oft ich die Strömung auf der Haut spüren wollte – wie das Streicheln liebevoller Hände, die den Körper bitten, die alten, schweren Energien loszulassen. Die Sonnenstrahlen umarmten mich zärtlich, der Mond und die Sterne ließen ihr sanftes Licht wie fürsorgliche Blicke auf meinem Körper ruhen.
Das einzig Schwierige war manchmal der Verstand, der rebellierte. Ich kam, um zu fühlen – denn das hatten wir verlernt. Wir leben in Konzepten, die unser Fühlen unterdrücken. Wir fürchten den Tod und weichen ihm ständig aus, anstatt zu begreifen, dass wir in jedem Moment sterben – und ewig leben. Loslassen. Vertrauen. Stattdessen vermeiden wir den Schmerz, konstruieren Ideen und Ablenkungen, damit der Verstand den ursprünglichen Schmerz nicht spüren muss. Dabei wäre es genau dieser Schmerz, der uns heilen könnte – wenn wir ihn zulassen.
Wir leisten Widerstand, führen Kriege, leiden an Konzepten, die vermeintlich besser zu ertragen sind als das unausweichliche Akzeptieren von Vergänglichkeit. Leben und Tod tanzen miteinander. Und
vielleicht ist es nicht der Tod, der schwer zu ertragen ist – sondern die Unendlichkeit.
Aber auch der Tod ist nur ein Konzept.
Der Dschungel – die Natur – zeigt mir mein wahres Selbst: Verbundenheit, Vibration, Liebe. Hier heilt, was wund und schmerzhaft ist. Hier fallen alle Konzepte ab. Mein Ego weicht auf. Mein Herz
ist erfüllt von Demut und Dankbarkeit.
Mama Selva nimmt mich in ihre Arme, flüstert durch den Wind, hält mein Herz in ihren Händen und zeigt mir die Schönheit des göttlichen Ursprungs in allem.
Ich habe keine Angst mehr – auch wenn sie nicht ganz verschwunden ist. Sie ist eine Strömung in meinem fühlenden Körperraum, wie auch Freude mich durchströmen kann. Ich löse mich von den Geschichten, die mein Ego erzählt, wenn Gefühle auftauchen. In meinem Kopf finde ich keine Wahrheit. Aber ich kann lernen, sie zu fühlen.
Ich werde wieder in den Dschungel reisen. Ich möchte weiter lernen – von Mama Selva.
Ich möchte den Weg der Heilerin gehen, wissend, dass der erste Schritt dorthin immer die eigene Heilung ist.
Zurück zur Natur heißt: zurück zur eigenen Natur, zur wilden Kraft der Schöpfung.
Indem ich dem Schmerz erlaube zu sein, erlaube ich auch der Liebe zu sein.
Ein Tanz mit der Unendlichkeit.

Jede Blüte will zur Frucht,
Jeder Morgen Abend werden,
Ewiges ist nicht auf Erden
Als der Wandel, als die Flucht.
Auch der schönste Sommer will
Einmal Herbst und Welke spüren.
Halte, Blatt, geduldig still,
Wenn der Wind dich will entführen.
Spiel dein Spiel und wehr dich nicht,
Laß es still geschehen.
Laß vom Winde, der dich bricht,
Dich nach Hause wehen.
Hermann Hesse
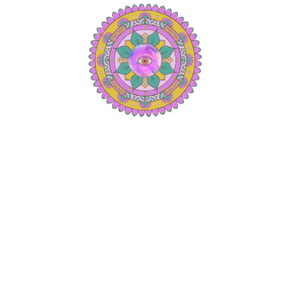












Kommentar schreiben